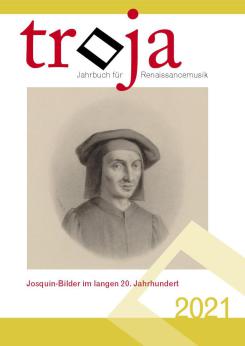Heidelberg, Internationales Wissenschaftsforum, 9.-11. Nov. 2023
Kollaborative Praktiken
in den Künsten der Frühen Neuzeit
Leitung: Prof. Dr. Christiane Wiesenfeldt und Roman Lüttin M.A. (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) in Verbindung mit
Prof. Dr. Nicole Schwindt (Staatl. Hochschule für Musik Trossingen)
Künstlerisches Handeln unterliegt durch das Paradigma individueller Autorschaft bis heute zumeist einer individualpoetischen Lesart, obwohl sich kulturelle Akte und Artefakte nur in den seltensten Fällen ausschließlich den Leistungen Einzelner verdanken. Obwohl kollaborative Handlungszusammenhänge und kreative Vernetzungen zu allen Zeiten grundlegend für künstlerische Produktions- und Schaffensprozesse waren, ist eine umfassende Auseinandersetzung mit ihnen bis heute nur in Einzelfällen, nicht aber in größeren zeitlichen und fachübergreifenden Zusammenhängen erfolgt. Indem die Tagung kollaborative Praktiken in den Künsten vom 15. bis zum 17. Jahrhundert aus einer interdisziplinären Perspektive befragt, können über die Spezifika der einzelnen Kunstdisziplinen hinaus Gemeinsamkeiten, aber auch Brüche und Kontinuitäten frühneuzeitlichen kollaborativen Handelns sichtbar werden. Entsprechend sollen nicht allein die Resultate von Kollaborationen – ob schriftlich fixiert oder ephemer – im Zentrum stehen, sondern jene Prozesse und Praktiken, die das gemeinsame künstlerische Arbeiten seit dem Spätmittelalter ausmachen. In vier Schritten nähert sich die Tagung ihrem Gegenstand:
Zunächst gilt es, die unterschiedlichen Kontexte künstlerischer Zusammenarbeit in der Frühen Neuzeit auszumachen. Unter welchen disziplinären, institutionellen, sozialen und personellen Voraussetzungen finden Kollaborationen statt? Welche Motive liegen den kollaborativen Aktionen zugrunde, welche Ziele werden damit verfolgt, welche Methoden werden gewählt, welche Arbeitsabläufe etablieren sich? Welche strukturellen Bedingungen befördern bzw. behindern die Zusammenarbeit? Lassen sich unterschiedliche Modelle von Kollaborationen erkennen? Und welche Auswirkungen auf unsere Vorstellungen künstlerischer Kreativität ergeben sich durch die verschiedenen Formen der Kooperation? Inwiefern sind diese Praktiken spezifisch für bestimmte Künste oder historische Zeitabschnitte?
In einem zweiten Schritt sollen die materiellen und immateriellen Spuren künstlerischer Zusammenarbeit thematisiert werden. Wie lassen sich Kollaborationen in den überlieferten Quellenkorpora identifizieren? Wie wird Zusammenarbeit in künstlerischen Kontexten medial realisiert und ggf. auch konzeptionell oder ästhetisch reflektiert? Warum werden Kollaborationen in Artefakten der Frühen Neuzeit mitunter verborgen oder maskiert, andernorts aber ausgestellt oder gar inszeniert? Wann und warum treten welche an einer Arbeit beteiligten Akteure sichtbar hervor oder werden unsichtbar gemacht?
Ein dritter Aspekt betrifft das Verhältnis zwischen kollaborativen Praktiken und Autorschaft: Wer besitzt künstlerische Autorität und genießt Autonomie in kollaborativen Produktionskontexten, und in welchem Grad? Inwiefern wirken sich Praktiken künstlerischer Zusammenarbeit und die Art ihrer Präsentation auf unsere Vorstellungen von solitären und geteilten Autorschaften aus? Und wie sind plurale Autorschaften in einem Zeitabschnitt zu interpretieren, der in vielen Künsten zwar als Konsolidierungsphase des Individualautors und neuzeitlichen Künstlertypus gilt, in dem aber zugleich auch anonyme Überlieferungen eher die Regel als die Ausnahme sind?
Viertens und letztens stellt sich die Frage nach den Wirkungen und Folgen, nach den produktiven und transformierenden Effekten von Kollaborationen: Wie beeinflussen kollaborative Handlungen personelle und institutionelle Netzwerke, künstlerische Transfer- und Rezeptionsbewegungen? Wie konstituieren und verändern sich durch Kollaborationen künstlerische Profile oder Zugehörigkeiten zu sozialen Räumen?
Begleitet wird die inhaltliche Perspektive in allen vier Aspekten stets von der Frage nach dem methodischen Zugriff bei der Untersuchung: Wie kann sinnvoll zwischen den Begriffen Kollaboration, Kooperation, Interaktion und Co-Kreativität differenziert werden? Worin unterscheiden sich diachrone und synchrone Praktiken der Kollaboration? Und welche Zugriffe der Forschung auf einen bereits gut erforschten Raum der Kollaboration - die bildkünsterische Werkstatt - sind für andere Disziplinen und Modell der Zusammenarbeit brauchbar?
Programm siehe unter Kolloquium 2023